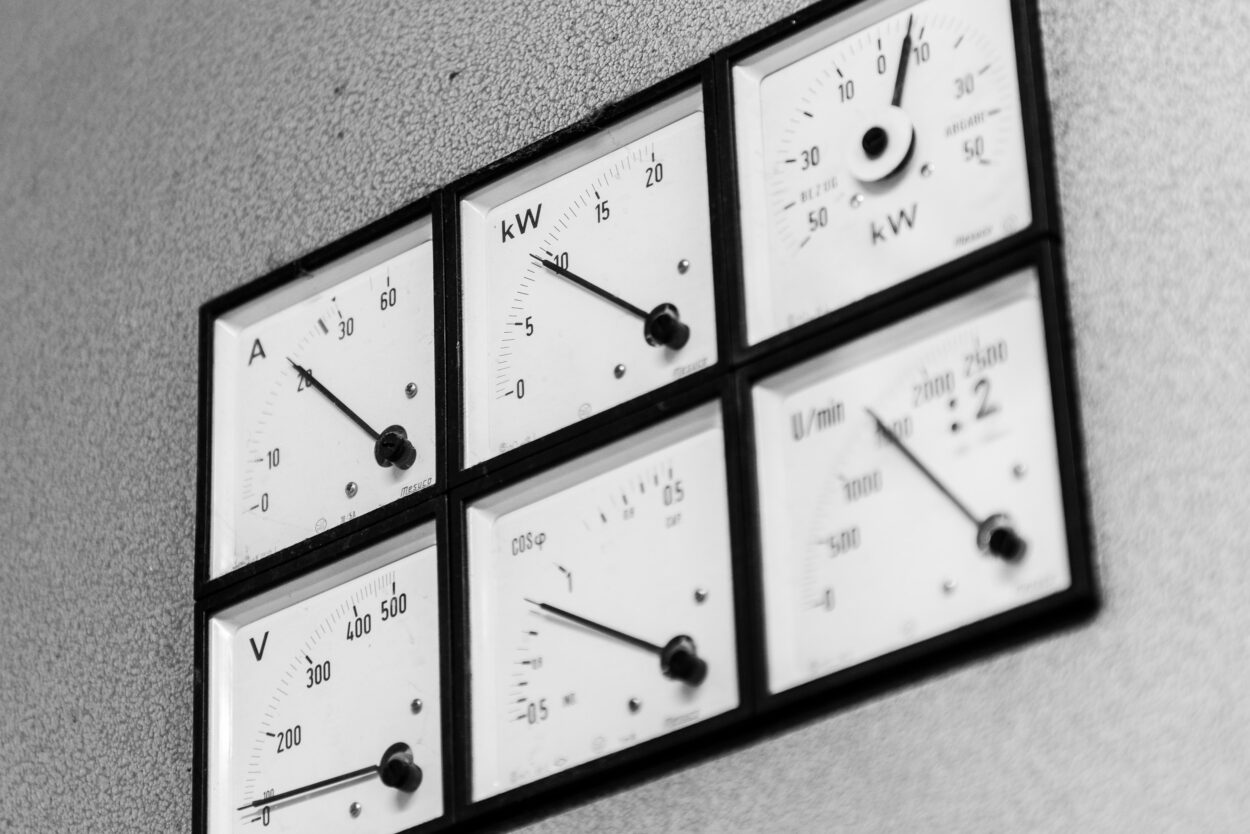Wenn die Welt sich selbst erzählt: Von der Grünerle und philosophischen Erfahrungen aus der Kunst
Die Grünerle ist sowohl für die alpine Flora und Fauna als auch in ökologischer Hinsicht problematisch. Als konkrete Herausforderung in Bergregionen versinnbildlicht sie die vielschichtigen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur – und regt zur Reflexion über das eigene Naturverständnis an.
Auf dem Windigegg im Glarner Linthal befindet sich die von mir daheim am nächsten gelegene Grünerlenpopulation, die im BAFU-Forschungsprojekt zur Verbreitung der Grünerle in der Ostschweiz kartiert ist. Die Alpen- oder Grünerle breitet sich seit einigen Jahrzehnten auf Alpweiden massiv aus und bildet inzwischen 70 Prozent des Gebüschwalds in den Schweizer Alpen. Ihren Ausbreitungserfolg verdankt die Grünerle, welche als «einheimisch invasiv» bezeichnet wird, unter anderem der Fähigkeit, Luftstickstoff zu fixieren. Wie die Kleearten lebt auch die Grünerle in Symbiose mit sogenannten «Knöllchenbakterien». Diese binden den Stickstoff aus der Luft und geben ihn an die Grünerle weiter, wodurch der Boden mit Stickstoff angereichert wird. Überschüssiger Stickstoff wird teilweise ausgewaschen, wodurch er hangabwärts gelegene Flächen und Gewässer überdüngt, oder auch in Form von Treibhausgasen (zum Beispiel Lachgas oder Stickoxide) an die Luft abgegeben. Die Auswirkungen der Grünerle sind enorm. Sie ist unter anderem eine Konsequenz der zurückgehenden Nutzung und Pflege alpiner Flächen, die der Mensch in den letzten Jahrhunderten kultiviert hat. Je mehr ich mich mit den komplexen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Grünerle auseinandersetze, desto dringlicher wird die Reflexion über das eigene Naturverständnis.
Auf die Frage «Was ist Natur?» trägt Jede:r von uns unterschiedliche Antworten in sich, welche von unserem eigenen kulturell geprägten Weltverständnis zeugen. Die abendländische Denktradition hat im Laufe der Jahrhunderte ganz unterschiedliche Vorstellungen von «Natur» hervorgebracht – und mit ihnen je eigene Antworten auf die Frage, wie der Mensch zur Welt steht. Bei Spinoza etwa verschwindet die Trennung zwischen Mensch und Natur vollständig: In seinem pantheistischen Denken sind Gott und Natur ein und dasselbe, «deus sive natura». Der Mensch ist hier Teil eines umfassenden Ganzen. Locke hingegen verlagert den Fokus: Bei ihm wird Natur zum Rohstoff, der durch menschliche Arbeit in Eigentum überführt wird. Hier beginnt sich ein utilitaristisches Verhältnis zur Welt abzuzeichnen – Natur als Besitz, als Ressource. Kant wiederum betrachtet die Natur als Bühne für die Entfaltung des menschlichen Geistes. In seiner Ästhetik des Erhabenen wird die Erfahrung der Natur zum Spiegel unserer eigenen Vernunft; wir erkennen uns selbst im Angesicht des Grossen und Mächtigen. Und schliesslich idealisiert die Romantik die Natur als verlorenes Ursprüngliches, als das Echte, das es zu bewahren gilt, und schafft damit eine Gegenwelt zur entfremdeten Zivilisation.
Es gibt keine objektive Wahrnehmung
Diese unterschiedlichen Zugänge teilen trotz ihrer Gegensätzlichkeit eine grundlegende erkenntnistheoretische Voraussetzung: Sie operieren mit einer kategorialen Trennung zwischen dem erkennenden Subjekt und der zu erkennenden Natur als Objekt. In dieser Konfiguration bleibt die Natur stets das Andere gegenüber dem Menschen – sei es als Gegenstand der Bewunderung, der Bewahrung oder der Aneignung.
Doch dieses Verhältnis bleibt gefangen in einer fundamentalen erkenntnistheoretischen Aporie: Können wir überhaupt von Natur als etwas von uns Getrenntem sprechen? Bereits Kant zeigt in seiner Erkenntnistheorie, dass wir die Welt nur durch die Anschauungsformen von Raum und Zeit sowie die Kategorien des Verstandes erfassen: «Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.» Was die Welt «an sich» ist, bleibt unzugänglich. Nietzsche radikalisiert diese Einsicht zur unausweichlichen Perspektivität allen Erkennens: «Wir sehen alle Dinge durch den Menschenkopf an und können diesen Kopf nicht abschneiden.» Der vermeintlich objektive Naturblick ist immer Interpretation, nie reine Wahrnehmung.
Unsere Wahrnehmung kreiert Realitäten
Die Physikerin und Philosophin Karen Barad schlägt vor, diese Herangehensweise grundlegend zu überdenken. In ihrem Konzept des «agentiellen Realismus» verabschiedet sie sich von der Vorstellung einer objektiven Welt, die unabhängig der Beobachter:in existiert. Stattdessen spricht sie von «Intra-Aktion»: Phänomene entstehen nicht zwischen getrennten Entitäten, sondern erst im Vollzug der Beziehung selbst. Materie ist nicht ein Ding, sondern ein Tun. Realität entsteht nicht durch Abbildung, sondern durch gemeinsames Hervorbringen. Was aber bedeutet diese erkenntnistheoretische Verschiebung für unsere Vorstellung von Natur? Und wie lässt sich eine solche Einsicht nicht nur denken, sondern auch erleben? Gerade die Kunst kann hier eine entscheidende Rolle spielen – nicht als Herstellerin von Werken, sondern als Ermöglicherin von Erfahrung. Eine Kunst, die nicht länger darstellt, sondern einlädt. Nicht das fertige Werk steht im Zentrum, sondern der Prozess, in dem Subjekt und Objekt, Betrachtende:r und Betrachtetes, sich gegenseitig hervorbringen.
Prozessuale Kunst
John Cage hat das früh erkannt. In seinem Stück «4'33''» spielt der Pianist – nichts. Die Musik entsteht durch das, was sonst stört: das Husten im Publikum, das Knarren der Stühle, das Rauschen der Klimaanlage. Die Kunst verweigert sich als Objekt, und öffnet damit einen Erfahrungsraum. Nicht das Werk zählt, sondern das, was sich zwischen uns ereignet. In ähnlicher Weise entwickelte Pauline Oliveros ihre «Deep Listening»-Praxis – keine Komposition im traditionellen Sinne, sondern ein fortlaufender Prozess des konzentrierten Hörens, bei dem die Grenzen zwischen den Hörenden und dem Gehörten zunehmend verblassen. Die Kunst als Objekt verschwindet und hinterlässt eine transformierte Erfahrungswelt.
Olafur Eliasson schliesslich überträgt diesen Gedanken in den Raum. Sein «Weather Project», eine künstliche Sonne in der Tate Modern, war zunächst ein klassisches Kunstobjekt. Doch erst die Reaktion der Besucher:innen machte es zu dem, was es wirklich war: Die Menschen legten sich auf den Boden, spiegelten sich in der Decke, arrangierten sich zu neuen Formen. Das Kunstwerk bestand nicht in der Installation, sondern im Zusammenspiel. Das Werk verschwand – und wurde zu einer Welt.
Diese prozessuale Kunst löst sich im Idealfall selbst auf und hinterlässt nur noch die transformierte Erfahrungsebene, wie es Lucius Burckhardt in Bezug auf Design formulierte: «Gutes Design ist unsichtbar.» Übertragen auf den Kontext des agentiellen Realismus könnte man sagen: Gelungene Kunst bringt sich selbst zum Verschwinden, indem sie nicht mehr als vom Rest der Welt separiertes Objekt erscheint, sondern als spezifischer Modus des In-der-Welt-Seins, der die Grenzen zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Mensch und Natur, durchlässig macht.
Antworten in der Erfahrung
Diese künstlerischen Prozesse eröffnen Erfahrungsräume, in denen sich die erkenntnistheoretische Aporie nicht theoretisch, aber praktisch auflösen lässt. Sie ermöglichen, sich selbst als Teil eines dynamischen Netzwerks sich ständig verändernder Beziehungen zu erfahren – eines Weltwerdens, in dem die Kunst als Vermittlerin verschwindet und eine neue Wirklichkeit schafft.
Kehren wir zur Grünerle auf dem Windigegg zurück, welche als «einheimisch invasiv» bezeichnet wird. Was bedeutet das eigentlich? Ihre Ausbreitung geht aus komplexen Intra-Aktionen zwischen veränderten Bewirtschaftungsformen, Klimawandel und mikrobiellen Symbiosen hervor. In Barads Terminologie wäre die Grünerle weder passives Objekt noch aktive Verursacherin, sondern Teil eines sich kontinuierlich rekonfigurierenden Gefüges. Eines Netzwerks, das sich durch veränderte respektive gestörte Ökosysteme und Kultivierung durch den Menschen neu zu gestalten versucht. Hier kann die künstlerische Forschung ansetzen und Erfahrungsräume schaffen, in denen sich zeigt, dass auch wir Teil dieses Gefüges sind.
Die Antwort auf die Frage «Was ist Natur?» liegt vielleicht nicht in einer Definition, sondern vielmehr in einer Praxis des Sich-Einlassens. Unser Naturverständnis konfrontiert uns zugleich mit unserem Selbstverständnis, nach der Art, wie wir in der Welt sind. Und die prozessuale Kunst eröffnet uns einen Weg, diese Beziehung neu zu erfahren: als teilnehmende Akteurin in einem Beziehungsnetz, in dem die Grenzen zwischen Betrachtenden und Betrachtetem letztlich als das erscheinen, was sie immer waren – notwendige, aber vorläufige Konstruktionen.
Redaktion: Aline Stadler